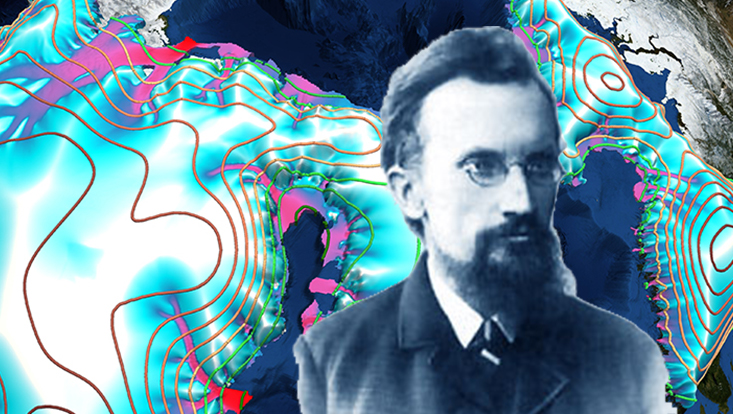and Society (CLICCS)
Wie die liberale Welt beim Klimaschutz herausgefordert wird
30. August 2023, von Franziska Neigenfind

Foto: Unsplash/Mika Baumeister
Von Klima- und Generationengerechtigkeit bis zur Regulierung von CO2-Emissionen – Bemühungen zur Eindämmung der Klimakrise haben vielfältige Normen hervorgebracht. Doch die damit verbundenen Pflichten sind oft umstritten. Wie sollen zum Beispiel Verantwortung und Lasten weltweit verteilt werden? Prof. Antje Wiener erforscht, wie gesellschaftliche Akteur:innen und Netzwerke die globale Steuerung für mehr Klimaschutz mitgestalten – in einer Zeit, in der die liberale Weltordnung in Frage gestellt und der Klimawandel zum Stresstest für die Demokratie wird.
Die Welt ringt in der Klimakrise um kooperative Lösungen. Wo geht es voran und wo stoßen Klimanormen auf Gegenwind?
Antje Wiener: Auseinandersetzungen um Normen können den nötigen Wandel vorantreiben, da sie bestehende Machtverhältnisse herausfordern. Bewegungen wie „Fridays for Future“ haben weltweit eine starke Stimme für den Klimaschutz geschaffen und soziale Veränderungen angestoßen. Auch sehen wir erfolgreiche Gerichtsprozesse, die Druck auf Regierungen und Unternehmen ausüben. Doch umgekehrt gibt es auch Klagen gegen Klimaschutzmaßnahmen.

Ebenso richten sich pauschale Ressentiments gegen sie. Worin gründet diese Ablehnung?
Wiener: Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, sind umfassende staatliche Maßnahmen nötig. Insofern ist der Klimawandel eine Herausforderung für die liberalen Prinzipien der individuellen Freiheit. Normen und Regeln werden dann in Frage gestellt oder kritisiert, wenn sie von Teilen der Gesellschaft oder der Weltgemeinschaft als aufgezwungen empfunden werden. Wir können beispielsweise eine Skepsis des globalen Südens gegenüber dem globalen Norden beobachten. Vorschriften für den Klimaschutz werden als Übergriffe wahrgenommen, gegen die Staaten und gesellschaftliche Gruppen aufbegehren. Dies lässt sich mit den Reaktionen auf die Erweiterungspolitik der EU vergleichen: Die östlichen Länder fühlen sich verpflichtet, immer neue Regeln zu implementieren. Das ruft populistische Kräfte auf den Plan. Dabei werden Grundelemente der liberalen Demokratie selbst angefochten. Die entsprechenden Auseinandersetzungen können dann einen autoritären Drall erhalten.
Sie stellen fest, dass solche Strömungen nicht nur gegen Normen gerichtet sind, sondern die gesamte liberale Ordnung stören?
Wiener: Wir beobachten unter anderem in den USA, Ungarn, Polen und im Vereinigten Königreich, dass Verträge nicht mehr eingehalten werden. Das schwächt die internationale Ordnung und zeigte sich besonders drastisch, als sich die USA als einer der größten Emittenten von Treibhausgasen aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzog. Insgesamt sind solche Backlashes wahrscheinlicher geworden.
Dabei erfordert der Klimawandel mehr Zusammenarbeit und rasches Handeln.
Wiener: Ja, problematisch ist allerdings die starke Polarisierung der Politik. In den USA sind die Gräben so tief, dass die beiden regierenden Parteien die Gesellschaft nicht mehr angemessen repräsentieren können. Gleichzeitig lassen sich Handlungsspielräume nutzen. So blieb etwa der Bundesstaat Kalifornien unter Präsident Donald Trump konsequent progressiv und ergriff eigene Maßnahmen und Initiativen im Sinne der Klimapolitik der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaabkommens.
Und die Möglichkeiten der Gesellschaft?
Wiener: Normen bieten uns Orientierung. Sie sind quasi der Klebstoff der Gesellschaft. Wir können sie nutzen und Organisationen, Initiativen und Netzwerke für mehr Klimaschutz unterstützen. Gesellschaftlich und politisch können wir uns vielfältig engagieren – zum Beispiel in lokalen Projekten, im Verein, am Arbeitsplatz, in der Bildung und vor allem an der Wahlurne. In CLICCS werden wir diese wichtigen Einflussmöglichkeiten weiter untersuchen.
CLICCS Quarterly
Der Artikel wurde im Magazin CLICCS Quarterly veröffentlicht, den Forschungsnews des Exzellenzclusters "Klima, Klimawandel und Gesellschaft".