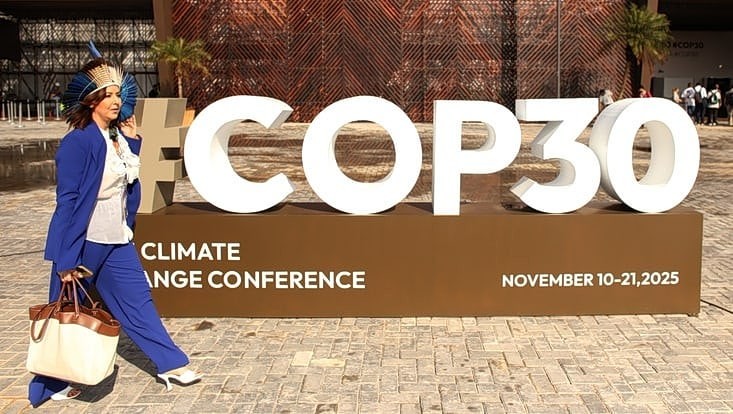and Society (CLICCS)
Weltklimakonferenz COP26Das Ende fossiler Energien: Dran glauben, hilft
28. Oktober 2021, von Stephanie Janssen

Foto: UN ClimateChange
Am Sonntag beginnt in Glasgow die 26. Weltklimakonferenz, die COP26. Der Soziologe Prof. Stefan Aykut erforscht seit 2007 Klimakonferenzen und die dahinterliegenden Mechanismen. Politikwissenschaftler Dr. Jan Wilkens untersucht die unterschiedlichen Vorstellungen von Klimagerechtigkeit in besonders betroffenen Regionen. Beide arbeiten am Exzellenzcluster für Klimaforschung CLICCS der Universität Hamburg und sind in Glasgow vor Ort.
Stefan Aykut, Jan Wilkens, welches Thema steht auf der COP26 in Glasgow im Vordergrund?
Stefan Aykut: Die britische Präsidentschaft der Konferenz hat vier Kernthemen definiert: Erstens, dass die Staaten ihre Ziele zur Treibhausgasminderung erhöhen, damit die 1,5 Grad-Grenze noch gehalten werden kann. Zweitens, dass die Anpassung an den Klimawandel entschiedener vorangetrieben wird. Drittens, dass die Länder des globalen Südens finanziell unterstützt werden. Hier wurde vor Jahren ein Ziel von 100 Milliarden Dollar pro Jahr für Anpassung und Emissionsminderung festgelegt, das aber dieses Jahr voraussichtlich verfehlt wird. Viertens sollen endlich die letzten verbleibenden Punkte des sogenannten Paris Rulebook, also des Regelwerks zur Umsetzung des Pariser Klimavertrags von 2015 fertiggestellt werden. Interessant ist, dass die ersten drei dieser Punkte gar nicht Teil der offiziellen Verhandlungen sein werden, sondern im Prinzip freiwillige Entscheidungen der Staaten sind. Damit wird auch klar, dass die Verhandlungen selbst immer weniger im Fokus stehen. Es geht vor allem um Fragen der Umsetzung.
Jan Wilkens: Verschiedene soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Akteure werden das Thema Gerechtigkeit prominent auf die Agenda setzen. Die Frage, wie gerechte Klimazukünfte aussehen und welche Wege dorthin führen sollten, ist eine enorme Herausforderung und auf ganz verschiedenen Ebenen umstritten. Welche Akzente und Forderungen werden nicht nur formuliert, sondern auch berücksichtig? Die Organisation der COP ist dabei auch praktisch eine große Herausforderung. Viele Aktive haben sich dazu entschieden nicht anzureisen, weil sie die COP nicht als geeignetes Format sehen. Andererseits können viele Aktive auch kaum anreisen, weil finanzielle und organisatorische Hürden, zum Beispiel bei der Einreise, enorm hoch sind und für viele nicht zu tragen. Aus dieser Situation ergibt sich die Frage, wie überhaupt über eine gerechte Zukunft gesprochen werden kann, wenn betroffene zivilgesellschaftliche Akteure abwesend sind. Es geht aber auch darum, ob die COP überhaupt ein geeignetes Instrument ist, im Sinne einer gerechteren Form der internationalen Zusammenarbeit.
Was sollte dieses Jahr in Glasgow erreicht werden ? Was finden Sie wichtig – und was können wir erwarten?
Stefan Aykut: Die COP26 in Glasgow ist die erste nach der Corona-Unterbrechung von 2020. Es ist auch die erste Konferenz nach dem Inkrafttreten der Pariser Übereinkunft. Und obwohl es in den letzten Jahren positive Zeichen gab – der Preisverfall bei Erneuerbaren etwa, oder die Ankündigung von Netto-Null Emissionszielen von vielen Ländern – reichen die Anstrengungen im Moment bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung einzudämmen. Globale Konferenzen wie diese werden daran nichts grundsätzlich ändern, da die Umsetzung weitgehend im nationalen Kontext stattfindet. Hier müssen die entscheidenden Weichen gestellt werden. Dennoch sind solche Konferenzen wichtig, weil sie Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Sie bieten neue Möglichkeiten zur Vernetzung von Klimaaktivist:innen, aber auch für Firmen und Städte. Wenn die Klimabewegung so wieder Auftrieb bekommt, kann dies den Druck auf politische und private Akteure erhöhen.
Jan Wilkens: Nach der langen pandemiebedingten Pause, ist es für die sozialen Bewegungen wichtig, sich zu treffen, zu vernetzen und zu organisieren. Wie verhalten wir uns in Zukunft zur COP, insbesondere wenn es bei der Umsetzung weiterhin keine sichtbaren Erfolge gibt? Wie schaffen wir gerechte und globale Bewegungen vor dem Hintergrund, dass Menschen aus dem sogenannten globalen Süden und der Arktis-Region schon längst hart von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Dadurch verändern sich nicht nur ihre Lebenssituationen maßgeblich, sondern auch ihre Möglichkeiten, aktiv zu sein.
Welche Länder preschen eher vor, welche bremsen?
Stefan Aykut: Das ändert sich von Konferenz zu Konferenz etwas. Die USA sind mit Präsident Joe Biden zwar wieder zurück auf der Klimabühne, haben aber große Schwierigkeiten, ihre Versprechen auch innenpolitisch durchzusetzen. China und Indien sind große Emittenten und zum Teil auch schwierige Verhandlungspartner, da sie stark auf ihr Recht auf Entwicklung pochen. In den letzten Jahren sind vor allem Australien und Brasilien dadurch aufgefallen, dass sie wichtige Verhandlungspunkte blockiert haben. Die Europäische Union positioniert sich in diesem Kontext gerne als Vorreiterin. Kürzlich wurde das „Fit for 55“ Paket vorgestellt. Mit diesem Bündel an Maßnahmen will die EU „Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent“ machen und sich so als Musterschülerin präsentieren. Ob das gelingt, ist aber nicht so sicher. Auch hier werden sehr starke Konflikte sichtbar, zum Beispiel zwischen den östlichen Mitgliedsstaaten und dem Rest.
Jan Wilkens: Spannend wird, wie sich Länder wie Russland oder Saudi-Arabien verhalten, die im Vorfeld öffentlichkeitswirksam ihre Klimaziele vorgesellt haben.
Welche Forschungsfrage interessiert Sie persönlich dieses Jahr besonders?
Jan Wilkens: Meine Kollegin Alvine Datchoua-Tirvaudey und ich werden uns anschauen, wie das Thema Klimagerechtigkeit diskutiert wird. Uns interessieren die sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Akteure. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf indigene Akteure aus der Arktisregion sowie aus dem Mittelmeerraum, zum Beispiel in West Asien und Nordafrika. Beide Regionen sind global betrachtet schon heute überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen.
Stefan Aykut: Ich werde mich vor allem mit etwas beschäftigen, was man das „Theater der Transparenz“ nennen könnte, also mit der öffentlichen Diskussion über Maßnahmen von Staaten und auch Firmen. Was muss da offengelegt werden, wie wird das präsentiert und vor welchem Publikum wird das diskutiert? Das sind ganz zentrale Fragen für die Umsetzung des Pariser Vertragswerkes, das ja auf Freiwilligkeit beruht.
Herr Aykut, Sie sagen, eine positive Erzählung – ein so genanntes Narrativ – ist wichtiger als die tatsächlichen Verhandlungsergebnisse. Warum das?
Stefan Aykut: Die Umsetzung des Pariser Abkommens beruht auf Freiwilligkeit. Alle Staaten können also nach Gusto Klimapläne vorlegen, die dann zwar kollektiv diskutiert werden, aber erst einmal nicht international verbindlich sind. Wir haben in unserer Forschung gezeigt, dass das aber nicht alles ist. Die Architekt:innen der Pariser Übereinkunft setzen gleichzeitig darauf, dass die Einigung auf gemeinsame Ziele, die nationalen Klimapläne und die jährlichen Konferenzen eine Art Sogwirkung ausüben. So sollen private Akteure wie Firmen und Investor:innen davon überzeugt werden, dass eine Abkehr von fossilen Energien bevorsteht und fossile Investments nicht mehr rentabel sind. Und wenn sie das glauben, wird es auch wahrscheinlicher. Das ist der Trick. Wichtig ist allerdings, dass dies bisher vor allem eine Hoffnung ist, vielleicht auch ein frommer Wunsch. Wir müssen besser verstehen, wie globale Konferenzen wie die COP26 die Erwartung von Akteuren wirklich beeinflussen.
Das Tolle an den COPs ist einerseits, dass alle Länder an einem Tisch sitzen und im Idealfall ein gemeinsames Ziel verabschieden. Aber sind wir nicht zu langsam, wenn stets nur der kleinste gemeinsame Nenner erreicht wird?
Stefan Aykut: Im Rahmen des UN Systems und der Klimarahmenkonvention lässt sich das kaum auflösen. Hier sitzen erdölexportierende und rohstoffreiche Länder mit am Tisch und können mit einem Veto jede Entscheidung blockieren. Es braucht daher komplementäre Initiativen, zum Beispiel zu Erneuerbaren Energien, oder auch die aktuelle Bewegung für einen Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energien. Es wären auch weitere Teilverträge zu spezifischen Sektoren denkbar. So könnten einige Länder vorangehen, und die Ergebnisse dann gegebenenfalls später in die Klimarahmenkonvention eingespeist werden.
Jan Wilkens: Wichtig ist auch, zu unterscheiden, dass hier vor allem Staaten und deren Repräsentant:innen am Verhandlungstisch sitzen. Daraus ergibt sich zusätzlich die Frage der Inklusion von wichtigen nicht-staatlichen Akteuren. Auch unter diesen gibt es natürlich sehr unterschiedliche Interessen und Vorstellungen. Aber einen Modus der besseren Inklusion zu finden ist für die Klimagovernance – also auch die tatsächliche Durchführung von Maßnahmen – wichtig. Da geht es nicht nur um die Quantität der Teilnehmer:innen, sondern auch um die Vielfältigkeit von Wissen, das es global zum Klima gibt, das häufig aber kaum berücksichtigt wird.
Innerhalb dieses Systems, das auf Wachstum und Ressourcenausbeutung ausgelegt ist, also im Kapitalismus, kann im Grunde keine wirkliche Umkehr stattfinden – wie ambitioniert die Vereinbarungen auf den COPs auch sein mögen. Kann das Wachstumsdogma jemals vom Thron geholt werden?
Jan Wilkens: Das ist eine zentrale Frage. Ich bin hier leider kein Experte, aber die Debatten unter dem Konzept „Degrowth“ werden auch im westlichen Kontext immer prominenter. Trotzdem ist es noch kein Thema das in der Breite wahrgenommen wird. Im Bundestagswahlkampf haben wir gesehen warum: Es ist entweder eine Art Tabuthema oder es wird stigmatisiert (Stichwort: Verbotspartei). Besonders mit Blick über den „westlichen Tellerrand“ wird deutlich, es geht um die Frage des Verhältnisses von Mensch und Natur.
Auf die Spitze getrieben: Was bringt mehr, die Fridays For Future-Proteste – oder Weltklimakonferenzen?
Stefan Aykut: Klimakonferenzen sollten als Kristallisationspunkte verstanden werden, in denen verschiedene Entwicklungen zusammenlaufen. Die Frage ist also nicht, was wichtiger ist. Sicherlich bewirken globale Konferenzen wenig, wenn die Zivilgesellschaft keinen Druck auf Regierungen ausübt. Hätten wir aber ohne die seit den 1990er Jahren veranstalteten Klimakonferenzen heute eine solche Aufmerksamkeit für das Thema? Klimaproteste berufen sich auf die Temperaturziele der Pariser Übereinkunft. Bei Klimaklagen, wie der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht, ist das ganz ähnlich. Die Frage ist also, wie sich die Dynamik verschiedener Bewegungen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gegenseitig verstärken kann. Das war ja auch in dem kürzlich veröffentlichten Hamburg Climate Futures Outlook schon ein zentraler Punkt.
Mehr zur Forschung
Wenn Klimaschutz beschworen wird
Die Dissonanzen des Klimagipfels
Klimagerechtigkeit – wichtig und konfliktträchtig
Ist das 1,5 Grad Ziel noch plausibel?
Der Hamburg Climate Futures Outlook
Kontakt
Prof. Dr. Stefan Aykut
Universität Hamburg
CLICCS - Exzellenzcluster für Klimaforschung
E-Mail: stefan.aykut"AT"wiso.uni-hamburg.de
Dr. Jan Wilkens
Universität Hamburg
CLICCS - Exzellenzcluster für Klimaforschung
E-Mail: jan.wilkens"AT"uni-hamburg.de